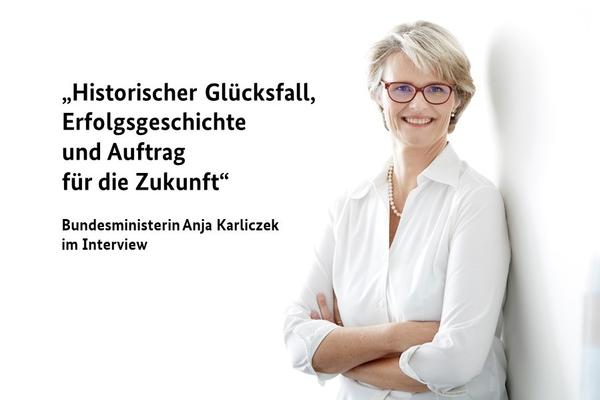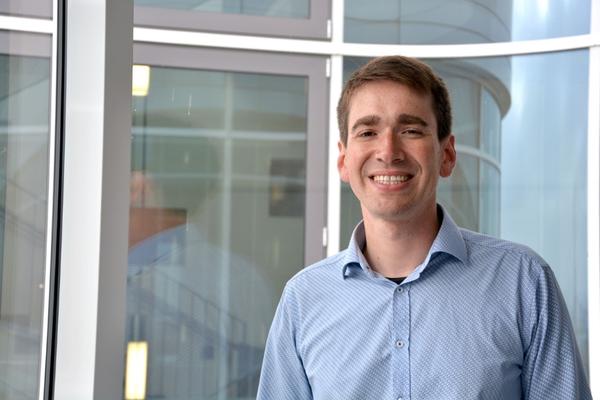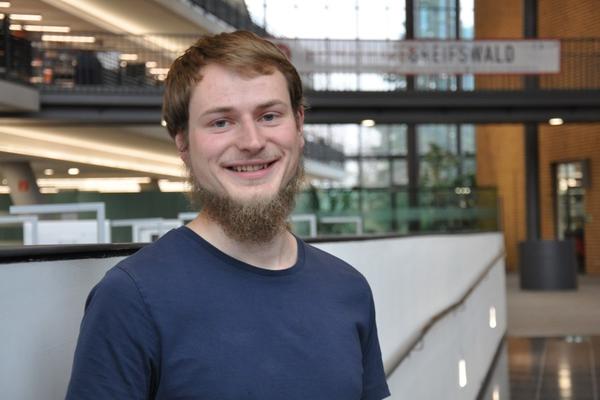Innovationen schaffen Zukunft!
30 Jahre Deutsche Einheit, aber auch 20 Jahre regionenorientierte Innovationsförderung des Bundesforschungsministeriums und 10 Förderprogramme: Das Jahr 2020 bietet viele gute Gründe zu feiern, zurückzuschauen und nach vorne zu blicken!
Wer das Wendejahr 1989 und das Einheitsjahr 1990 miterlebt hat, hat seine ganz eigenen Bilder im Gedächtnis, seine eigenen Emotionen im Gepäck. Das betrifft in erster Linie die damals 16 Millionen Ostdeutschen, deren Leben sich binnen kürzester Zeit völlig gewandelt hat. Eine umfassende Bilanz kann es deshalb auf dieser Jubiläums-Website nicht geben. Eines aber ist klar: Die Deutsche Einheit ist eine „beispiellose Erfolgsgeschichte“, wie die Bundesministerin für Bildung und Forschung, Anja Karliczek, feststellt. Im Interview wirft sie einen ganz persönlichen Blick zurück in das Jahr 1990 – und gibt einen Ausblick in die Zukunft strukturschwacher Regionen in ganz Deutschland.
Auf das Jahr 2020 fällt das 30. Jubiläum der Deutschen Einheit, aber auch das 20. Jubiläum einer Innovationsförderung des Bundesforschungsministeriums, die die Regionen in den Mittelpunkt stellt. Seit der Jahrtausendwende wurden im Rahmen von „Unternehmen Region“ und „Innovation & Strukturwandel“ etwa 600 Initiativen mit finanziellen Mitteln von rund 2,2 Milliarden Euro gefördert.
Die wichtigsten Zahlen auf einen Blick

Noch beeindruckender als diese Zahlen sind die weit über 10.000 Menschen, die sich bislang an den geförderten Initiativen beteiligt haben. Menschen, die mit ihrem Engagement, ihrer Überzeugungskraft und ihren Ideen begeistern. Menschen, die die vergangenen 30 Jahre nicht nur miterlebt, sondern mitgestaltet haben. Und Menschen, die diese spannenden Entwicklungen aus einer wissenschaftlichen Perspektive begleitet haben. Einige besonders beindruckende Persönlichkeiten können Sie nun kennenlernen:
30 Jahre – 30 Menschen
Mit dem Start von „REGION.innovativ“ umfasst die regionenorientierte Innovationsförderung des Ministeriums mittlerweile zehn Einzelprogramme in zwei Programmfamilien. Jedes der zehn „Unternehmen Region“- sowie „Innovation & Strukturwandel“-Familienmitglieder ist einzigartig und dreht an anderen Stellschrauben im Innovationsprozess.
Die 10 Programme
Für Bundesministerin Anja Karliczek ist die Deutsche Einheit ein historischer Glücksfall und eine Erfolgsgeschichte, aber auch „ein Auftrag für die Zukunft“. Und ist das nicht der eigentliche Sinn von Jubiläen: die Vergangenheit nicht um ihrer selbst willen zu würdigen, sondern um daraus etwas für heute oder vielleicht sogar für morgen zu lernen?